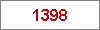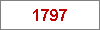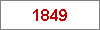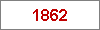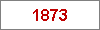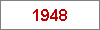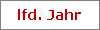Chronik einer Insel
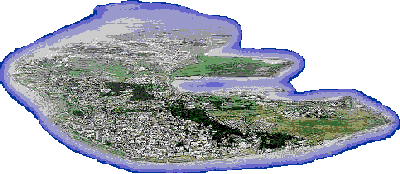
Chronik der Insel | Betriebe und Einrichtungen | Insel und Küste | Insel und Stadt Historisch | Küstenschutz | Presse | Vereine
Norderneyer Badezeitung | Norderney Kurier
 Presse | Norderneyer Badezeitung | Sonderausgaben | Badekuriere: Frühjahrsausgaben | Sonderausgaben | Weihnachtsausgaben | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2003
Presse | Norderneyer Badezeitung | Sonderausgaben | Badekuriere: Frühjahrsausgaben | Sonderausgaben | Weihnachtsausgaben | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2003Ungewöhnliche Wetterverhältnisse beschäftigten die Gemüter der Insulaner während des Winters in besonderer Weise. Aus dem Winter 1708/1709 berichten alte Handschriften, daß am 14. März noch der sandige Boden auf dem Friedhof drei Fuß tief gefroren war. Im gleichen Jahre verzeichnet man am 16. Mai starken Schneefall! Fünf Jahre später war der Winter noch härter. Am 17. Juni fror es noch und am 3. August bedeckte Reif die Häuser und Bäume. Daß die Insulaner aber auch während der kalten Jahreszeit keineswegs untätig waren, geht aus einem 1822 verfaßten Büchlein hervor, das der eigentliche Begründer des Nordseebades Norderney, der Medizinalrat von Halem, verfaßt hat. Der verdiente Arzt schreibt dort: "Als im Februar 1795 das englische Armeekorps unter Lord Catheart aus den Niederlanden in Ostfriesland einrückte, war es während des starken Winterfrostes nicht möglich, Nachrichten nach England zu schaffen. Nur den Norderneyer Fischern glückte es, den nachherigen Admiral Home Popham von der Reede der Insel aus bald in See zu bringen. Deshalb überzeugte man sich von dem Nutzen, hier eine Station für Paquetböte anzulegen." Die Kriegführenden, Preußen und Frankreich, schlossen allerdings dann bald Frieden, so daß aus diesem wohl ersten Versuch einer Aktivierung des Winterhalbjahres für die erwerbstätige Bevölkerung der Insel nichts wurde.
Anstelle der heutigen Stadt duckten sich zu jener Zeit eingeschossige Fischerhäuser hinter den Dünenrändern, Backsteinbauten mit Mauern, die meist nur eineinhalb Steine stark waren. Holländische Pfannen oder Strohdorken bildeten den Dachbelag. Im Hausinnem war es überaus behaglich und wohnlich. Ein windabgekehrter Vorraum, der seitlich eine Sitzhank aufwies, schützte vor dem oftmals wütend anspringenden Sturm. In der Küche, um den mit Delfter Fliesen geschmückten Kamin, kam man hauptsächlich zusammen. Hell und freundlich waren die Wohnstuben, die die seebefahrenen Insulaner oftmals wie Schiffskajüten eingerichtet hatten. Damit die zumeist vorherrschenden Westwinde die Dachfirste nicht allzuleicht abdecken konnten, herrschte die West-Ost-Bauweise vor. Jede Erderhöhung war ausgenutzt, um zusätzlichen Windschutz zu bekommen. Trotz ihrer leichten und sparsamen Bauweise pflegten die Bauten unserer Vorväter so zumeist Hunderten von Jahren standzuhalten.
Der Winter hatte einst aus besonderen Gründen für die Insulanerkinder einen wenig schönen Beigeschmack: sie mußten während dieser Zeit zur Schule gehen. Der Pastor mußte sich der sicherlich nicht immer dankbaren Aufgabe des Unterrichts widmen. Das Lernen dauerte vom 1. Advent bis Lichtmeß oder St. Petri. Es war dieses dann aber auch der späteste Termin; denn von nun an zogen die Seeleute mit ihren Jungen wieder auf große Fahrt. Um 1700 aber schon ordnete die Obrigkeit an, daß die Inseljugend auch im Sommer die Schule besuchen müsse.
Neben dem Ringen mit den Naturgewalten überschatteten manches Mal auch menschliche Tragödien das Winterdasein der Insulaner. Ein kranker Schiffer brachte im Winter 1759/60 eine furchtbare Geißel auf die Insel, die sogenannte "rote Ruhr". In verhältnismäßig kurzer Zeit wurden über 100 Menschen der sonst kerngesunden Bevölkerung dahingerafft. - Im vorigen Jahrhundert fuhr der Sohn eines Kapitäns - es war gerade Heiligabend - heim zur Insel. Ohne der schlechten Sicht zu achten, sprang er, als die Jolle, die ihn an Bord hatte, eine Landspitze erreichte, aus dem Boot, um schneller unter dem Lichterbaum zu sein, als seine Kameraden, die mit dem Boot bald in der Dunkelheit verschwanden. Der Unglückliche schritt kräftig voran - und sollte doch seine Lieben nie mehr Wiedersehen. Es war nicht die ersehnte Heimatinsel, auf der er sich befand, sondern eine der zahlreichen Sandbänke, die, bei Niedrigwasser im Wattenmeer trocken fallen. Eine zwei Monate später bei Wangerooge angetriebene Zigarrenkiste enthielt das Notizbuch des Vermißten. "Liebe Mutterl", hieß es darin, "Gott tröste Dich, denn Dein Sohn ist nicht mehr. Ich stehe hier und bitte Gott um Vergebung der Sünden. Seid alle gegrüßt. - Ich habe das Wasser jetzt bis an die Kniq ich muß gleich ertrinken, denn Hilfe ist nicht mehr da. Gott sei mir Sünder gnädig! - Es ist neun Uhr. Ihr geht jetzt gleich zur Kirche, bittet für mich Armen, daß Gott mir gnädig sei. - Liebe Eltern, Brüder und Schwester! Ich stehe hier auf einer Flute und - muß ertrinken, ich bekomme Euch nicht wieder zu sehen und Ihr mich nicht! Gott erbarme sich über mich und tröste Euch. Gott gebe, daß Ihr diese Zeilen von meiner Hand erhaltet. Ich grüße Euch zum letzten Mal. Gott vergebe mir meine Sünden und nehme mich in sein Himmelreich. Amen."
Ein Jahreswechsel mit ungewöhnlichen Hindernissen geschah vor genau 60 Jahren. Am Sonntag vor Silvester 1892 versuchte der Norderneyer Fährdampfer trotz starken Eisganges das Festland zu erreichen. Ein vergebliches Bemühen. Das Schiff mußte in den Inselhafen zurückkehren. An ein erneutes Auslaufen war nicht mehr zu denken. Ohne offensichtlich von den Schwierigkeiten zu wiesen, versuchte nun die "Katharina Elisabeth" von Norddeich aus nach Norderney durchzukommen. Nachdem das Schiff unter dem Kommando von Kapitän Saathoff 12 Stunden lang versucht hatte, sich aus den Eismassen zu befreien, mußte es die Notflagge setzen. Sofort machte man auf der Insel das Rettungsboot klar, um dem Schiff zum mindesten Lebensmittel zuzuführen. Auch dieser Versuch mißlang. Das Rettungsfahrzeug blieb ebenfalls hilflos stecken. Nun schien man am Ende der Kräfte zu sein. Telefonisch wurde in Wilhelmshaven um die schnellstmöglichste Entsendung eines schweren Marine-Eisbrechers gebeten, der beide Schiffe befreien könnte. In der Antwort hieß es, daß ein derartiges Schiff erst frühestens am Nachmittag des nächsten Tages einsatzbereit sein könne - also viel zu spät! Als letztes Mittel wurde die gesamte Einwohnerschafi alarmiert um den im Norderneyer Hafen liegenden Dampfer "Stadt Norden" für eine Rettungsexpedition loszueisen. Jung und alt, allen voran die Männer der Freiwilligen Feuerwehr, begannen mit dem Mute der Verzweiflung das Werk - und es gelang. Der Dampfer kam frei und nahm Kurs auf die festsitzenden Schiffe. Erst in den späten Nachmittagsstunden gelang es, bis zu dem Rettungsboot vorzudringen, dessen Besatzung aber acht Stunden lang vollkommen schutzlos dem grimmigen Frost ausgesetzt gewesen war. Das Boot konnte wohlbehalten eingeschleppt werden. Jedoch gelang es nicht mehr, zu dem Fährschiff durchzudringen, dessen Passagiere und Besatzung jetzt schon die zweite Nacht im Eise festsaßen. Noch einmal machte sich daher am nächsten Morgen die Inselbevölkerung an die Arbeit. Man schreibt in einem alten Zeitungsbericht darüber: "Es schien, als wenn ganz Norderney zum Hafen eilte". Abermals hatten die Bemühungen Erfolg. Der Hilfedampfer konnte sich bis auf etwa 300 Meter an das festsitzende Schiff heranarbeiten. Nach mehr als 50stündiger Gefahr vermochten die Passagiere im Fußmarsch die "Stadt Norden" zu erreichen, die jetzt allerdings Schwierigkeiten hatte, sich wieder rückwärts einen Weg durch das Eis zu bahnen. Da traf der Bremerhavener Hochseeschlepper "Vorwärts" ein, der mit seinen starken Maschinen beide Schiffe nach und nach aus dem Eise befreien konnte. In einer öffentlichen Belobigung an die Bevölkerung heißt es: "Die Tätigkeit aller Männer auf dem gefährlichen Eise war geradezu bewundernswert."
Aber auch in solchen Situationen wußte man sich mit Humor zu helfen. Der Frost hielt in diesem Winter lange an. Bis Mitte Februar war die Insel vom Festlande abgeschnitten. Bedauert wurde aber nur das Fehlen von Bier. Es heißt davon: "Wir lesen von unseren Nachbarinseln über den dort eingetretenen Mangel an verschiedenen Lebensmitteln, und können auch auf unserer Insel konstatieren, daß bei den Händlern für Geld und gute Worte kein Bier mehr zu haben ist. Nun sagt wohl mancher, ohne Bier läßt sich auch leben. So denken aber nicht die Herren Hoteliers, denn zwei derselben haben es ermöglicht, zehn Fässer "Doornkaat-Bräu" durchs Watt nach hier zu holen." Diese segensreiche Expedition wurde dann noch einmal auf allgemeinen Wunsch mit dem gleichen Erfolge wiederholt.