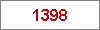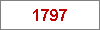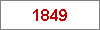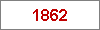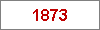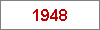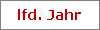Chronik einer Insel
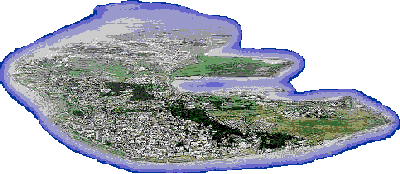
Chronik der Insel | Betriebe und Einrichtungen | Insel und Küste | Insel und Stadt Historisch | Küstenschutz | Presse | Vereine
Norderneyer Badezeitung | Norderney Kurier
 Presse | Norderneyer Badezeitung | Sonderausgaben | Badekuriere: Frühjahrsausgaben | Sonderausgaben | Weihnachtsausgaben | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2003
Presse | Norderneyer Badezeitung | Sonderausgaben | Badekuriere: Frühjahrsausgaben | Sonderausgaben | Weihnachtsausgaben | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | 2000-2003Eine Inselwanderung an dunklen Tagen
Schiffe wurden zum Sinnbild der Seele
 In einem in deutschen Fachkreisen wohlbekannten Werk über die unterirdischen Totenstädte Roms hat der römische Archäologe Guido Calza in besonderer Weise auf die Darstellung von Wasserfahrzeugen als Wandmalerei in Begräbnisstätten oder als Reliefs an vorchristlichen Sarkophagen hingewiesen. Roms frühchristliche Kunst hat diese Symbolik übernommen, sie aber mit ihrem Geiste erfüllt.
In einem in deutschen Fachkreisen wohlbekannten Werk über die unterirdischen Totenstädte Roms hat der römische Archäologe Guido Calza in besonderer Weise auf die Darstellung von Wasserfahrzeugen als Wandmalerei in Begräbnisstätten oder als Reliefs an vorchristlichen Sarkophagen hingewiesen. Roms frühchristliche Kunst hat diese Symbolik übernommen, sie aber mit ihrem Geiste erfüllt.
So findet man auch an christlichen Begräbnisstätten und Sarkophagen der auslaufenden Antike oft die Darstellung eines Bootes. Der Mann, der in ihm steht, ist durch Beischrift häufig als Noah ausgewiesen. Die frühen Künstler gaben auf diese Weise der Glaubenszuversicht Ausdruck, daß sich der Dahingegangene nun in Gottes Obhut befinde, gleichsam wie Noah in der Arche. Auch unbemannte Schiffe findet man vor, zugleich mit einem Vogel als Sinnbild der Seele.
Solche Schiffsdarstellungen befinden sich sehr häufig auch auf Dorffriedhöfen des norddeutschen Küstengebietes. Auch auf alten Norderneyer Gräbern sind Schiffe zu sehen. Da diese Grabsteine durch Inschrift als Denkmäler für Schiffer, Kapitäne oder Lotsen ausgewiesen sind, hat man die Reliefs lange Zeit nur als Berufssymbolik genommen. In eingehenderer Untersuchung schälte sich aber die Erkenntnis heraus, daß diese norddeutsche Grabsymbolik im Geiste jener frühchristlichen römischen Begräbnisstätten und Sarkophage aufzufassen ist.
Es ist auffällig, daß diese Hinwendung zu jener der römisch-frühchristlichen Symbolik so ähnlichen Grabkunst erst im 18. Jahrhundert erfolgte. Vorher war auf diesen Friedhöfen des norddeutschen Küstengebietes der Typ eines allgemeinen Andachtsmales mit dem Bilde des gekreuzigten oder gar auferstandenen Heilandes vorherrschend und unter vielen dieser Standmale lag auch gar kein Toter. Dann aber, schlagartig möchte man sagen, kommt jene im Bilde des Schiffes ausgedrückte persönliche Jenseitshoffnung auf den Grabstellen zum Durchbruch.
Das neue, bereits um die Wende des 17. Jahrhunderts einsetzende Thema hat eine bemerkenswerte Ouvertüre: die als unbekleidete menschliche Figur dargestellte Seele, die den langen Heimatwimpel schwingt. In Reliefs auf dem Kirchhof zu Döse bei Cuxhaven aus dem Jahre 1733 und in Bolxidum auf Föhr aus 1744 entdeckt man dieses Sinnbild der zum Himmel aufsteigenden und zu Gott heimkehrenden Seele noch in wappenartigen Feldern. Dann aber folgen ganze Schiffe als Sinnbilder der Seele. Die Segel sind zum Teil gerefft, zum Teil sind sie gerade eingeholt, die Wimpel flattern achteraus, was darauf hindeutet, daß das Schiff keine Fahrt mehr macht und daheim angekommen ist. Manchmal, wie in Westeraccumersiel, sieht man eine oder zwei Personen beim Segelmanöver, zum Zeichen, daß das Schiff auf anderen Kurs geht. In Kirchhammelwarden an der Unterweser schaukelt hinter dem Schiff an einer Leine das Beiboot auf den Wellen; in ihm steht der Mann, der das Schiff verlassen hat und nun an Land gehen will. Etwa hundert Jahre, bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts, dauerte diese der altrömischen so verwandte Grabsymbolik auf den Küstenfriedhöfen an. Dann treten an die Stelle der Schiffe ausgesprochene nautische Einzelzeichen auf, wie Schiffstonnen, Masten, Anker, Kompaß und Karte, die man nur als Berufssymbolik deuten kann, und die nicht mehr jenes feine antik-poetisch empfundene Dahingehen der menschlichen Seele erkennen lassen. Die an die römische Spätantike anklingende Grabkunst der Küstendörfer ist auf deutschem Boden einmalig geblieben. Die Namen der Steinmetze und ihre künstlerisch-handwerklichen Beziehungen, die jene Symbolik hier so plötzlich heimisch machten, sind nicht bekannt.